Wenn die KI mitlernt – Wie smart ist smart genug?
Text: Claudia von Löwenthal
„Die Hausarbeit war sprachlich auffallend gut. Viel zu glatt. Und in der Diskussion fehlte plötzlich die Tiefe, die ich sonst bei ihr sehe“, erzählt Dr. Carsten Kolbe. Er unterrichtet Kommunikation in der Sozialen Arbeit an der DIPLOMA und merkt immer öfter: Irgendetwas hat sich verändert. Seit KI-Tools wie ChatGPT frei verfügbar sind, ist bei vielen Studierenden der Ton – und manchmal auch der Inhalt – ein anderer.
Ganz anders sieht das Tobias, 6. Semester BWL: „Ohne die KI hätte ich das Semester nicht gepackt. Ich arbeite 25 Stunden die Woche, da ist Zeit mein knappstes Gut. Die KI hilft mir, den Überblick zu behalten und schneller auf den Punkt zu kommen.“
Zwei Perspektiven – ein Thema: Wie verändert Künstliche Intelligenz das Lernen?
Für die einen ist sie ein Gamechanger, für andere ein potenzieller Stolperstein für die Bildung. Lernhilfe oder Denkverzicht, Effizienzgewinn und ethische Grauzone? Es stellt sich eine Frage, die jede:r Studierende für sich beantworten muss: Wie viel KI ist noch ok?
Zwischen Turbo-Wissen und Denkpause
Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: KI im Studium wirkt. Eine umfassende Meta-Analyse von mehr als 45 Einzelstudien zeigt, dass KI-gestütztes Lernen eine Effektstärke von g = 0,70 erreicht – das entspricht einem deutlichen Lernfortschritt im Vergleich zum klassischen Unterricht. Was bedeutet „Effektstärke g = 0,70“? Die Effektstärke ist eine statistische Kennzahl in wissenschaftlichen Studien, mit der die Stärke eines Effekts oder Unterschieds zwischen zwei Gruppen beschrieben wird. g = 0,70 bedeutet, dass die untersuchte Intervention (hier: Einsatz von KI beim Lernen) eine mittlere bis große Wirkung auf das Lernresultat hat.
0,2 = kleiner Effekt (kaum spürbar, wenig praktisch relevant), 0,5 = mittlerer Effekt (gut messbarer Unterschied), 0,8 oder mehr = großer Effekt (sehr deutlicher Unterschied)
In anderen Studien verbesserten sich die Noten um bis zu 14 %, wenn regelmäßig mit KI-Tools gearbeitet wurde.
Besonders hilfreich sind Systeme, die sofort reagieren – etwa Chatbots oder KI-Lernassistenten, die in Echtzeit Feedback geben. Sie entdecken Wissenslücken, bevor sie zum Problem werden, schlagen passende Lerninhalte vor und motivieren durch ihren schnellen Support. Viele Studierende berichten: Mit KI lernen sie nicht nur strukturierter, sondern kommen auch zügiger ans Ziel.
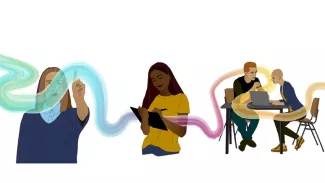
Aber: Nicht alles, was glänzt, ist auch Gold
Trotzdem bleibt Skepsis angebracht. Bildungsexperten warnen: Wer sich zu stark auf die KI verlässt, läuft Gefahr, das eigene Denken zu vernachlässigen. Studien zeigen einen Rückgang an kreativer Problemlösekompetenz und kritischem Denken – Fähigkeiten, die im Studium und später im Job unverzichtbar sind.
Hinzu kommt: Der Einsatz von KI funktioniert am besten ergänzend – nicht als Ersatz. Dort, wo smarte Tools die Lehre komplett übernehmen, bleiben oft Reflexion und Tiefe auf der Strecke. KI ist stark im Vermitteln – doch das Verstehen muss der Mensch leisten.
KI für alle? Noch nicht ganz
Ein weiteres Problem: der ungleiche Zugang. Wer früh mit KI in Berührung kommt, ist klar im Vorteil – versteht die Technik besser, spart Zeit, schreibt effizientere Arbeiten. Andere hingegen, die unsicher sind oder keinen Zugang haben, geraten ins Hintertreffen. So entsteht eine digitale Kluft, die neue Fragen der Bildungsgerechtigkeit aufwirft.
Deshalb braucht es klare Spielregeln und viel mehr Orientierung. Hochschulen stehen in der Verantwortung: Nicht nur technische, sondern auch ethische und didaktische Kompetenzen im Umgang mit KI müssen vermittelt werden. Denkbar wären Einführungsveranstaltungen, verpflichtende Kurse oder Leitfäden zur transparenten Nutzung in wissenschaftlichen Arbeiten.

Fazit: Gemeinsam mit der Technik – nicht hinterher
Eines ist sicher: KI kann das Lernen effizienter, individueller und motivierender machen. Doch dieses Potenzial entfaltet sich nur dann, wenn die Technik uns dient – und nicht umgekehrt.
Für die DIPLOMA Hochschule heißt das: Mitnehmen statt ausschließen, begleiten statt bevormunden. Und vor allem: Ein durchdachter Rahmen, der Chancen nutzt – ohne die Risiken zu übersehen. Denn wer heute studiert, lernt nicht nur für den Abschluss, sondern auch für eine Zukunft, in der Künstliche Intelligenz Teil unseres Denkens sein wird – im besten Fall: auf Augenhöhe.
Quellen:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07356331241240459
https://www.ccsenet.org/journal/index.php/hes/article/view/0/51474

Illustration: Charly Könecke
